Tod bedeutet Veränderung. Das weiß jeder, der schonmal einen Film mit einer Kartenlegerin gesehen hat. Die Kartenlegerin ist natürlich eine ältere Frau mit krummer Nase, die seltsamerweise mit russischem Akzent spricht. Die junge Klientin, denn natürlich ist es eine Frau, zieht mehrere Karten, deren letzte den Tod zeigt. Erschrocken lässt die Frau die Karte fallen, doch die Kartenlegerin beruhigt sie: “Todd is’ gutt. Todd bädeittet Verränderruung!” Die junge Frau geht daraufhin nach Hause und verliert meist kurz darauf ihren Verlobten oder ihre beste Freundin durch einen wahnsinnigen Axtmörder.
Wie viel sich für mich und mein Leben verändern würde, als mein Vater im November 2009 – für mich völlig überraschend – starb, konnte ich damals noch nicht absehen. Über den Tod habe ich zwar mein Leben lang viel nachgedacht, aber über Trauer fast gar nicht. Während ich alle Eventualitäten meines eigenen Todes und nahestehender Menschen durchdacht hatte, hätte ich auf die Frage “Was ist Trauer und was macht sie mit einem Menschen?” fast nichts sagen können.
Trauer, so dachte ich, ist der Prozess des Loslassens nach einem schweren Verlust. Trauer äußert sich bei jedem anders. Aber vor allem ist Trauer endlich. Man kommt über den Verlust hinweg und fertig. Kehrt zurück zu seinem alten Leben, seinem Alltag, macht die Dinge so, wie man sie immer gemacht hat.
In diesem letzten Punkt lag ich total falsch.
Durch den Tod meines Vaters und die sich unmittelbar anschließende Krebsdiagnose meiner Mutter hat sich sehr viel verändert. An unserem Familiengefüge natürlich, aber auch in mir drin, wie ich Dinge tue und wahrnehme.
[Ein kurzer Einschub für die zeitliche Einordnung: an einem Dienstag im November 2009 bekam ich von meiner Mutter einen Anruf, dass mein Vater sehr krank sei und sie beide deshalb mit meinem Bruder und mir reden wollen. Ich fuhr sofort nach Hamburg und blieb dort, bis mein Vater eine Woche später, am darauffolgenden Dienstag an seinem Lungenkrebs starb. Nur gut drei Monate danach wurde bei meiner Mutter ebenfalls Krebs festgestellt. Sie wurde sofort operiert und musste eine sechsmonatige Chemotherapie über sich ergehen lassen, die bis Ende Oktober 2010 ging. Bis zum heutigen Tag ist der Krebs nicht zurückgekommen.]
Ch-ch-changes
In unserer Familie war ich meinem Vater immer am ähnlichsten und als er tot war und meine Mutter von der Last der Chemo niedergedrückt wurde, glaubte ich, meinen Vater ersetzen zu müssen. Meine Mutter auffangen, Probleme lösen, Stärke und Zuversicht geben und dafür sorgen zu müssen, dass nicht alles auseinanderbricht. Viele Gespräche, mit meiner Therapeutin, mit meiner Mutter und mit meinem Mann, waren nötig, um mich von dem Druck zu lösen. Um meinen Unglückskomplex, zumindest innerhalb meiner Familie, auf ein erträgliches Maß herunterzufahren. Um aus dieser Dauerschleife von Mitgefühl, Sorge und gefühlter Verantwortung für alles und jeden ausbrechen und mir Raum für andere Gefühle geben zu können. Schmerz oder Wut zum Beispiel.
Zu meinem Bruder habe ich kaum noch Kontakt seit all dem. Nicht, weil wir uns nicht mögen, sondern weil wir in so verschiedenen Welten leben, dass immer ein Ausgleich nötig war, um uns zusammen zu bringen. Mein Vater hat diese Schleusenfunktion immer übernommen. Das wurde mir erst klar, als ich im Laufe der Zeit merkte, wie mein Bruder und ich immer mehr auseinanderdiffundieren.
Die Idee, mich nicht von den Menschen verabschieden zu können, die mir wichtig sind, war mir schon immer zuwider, aber nach all den schmerzhaften Erfahrungen bekam meine Fixierung auf Abschiede etwas Seltsames. Wenn mein Mann und ich eine Autofahrt machten, sagte ich spätestens beim Auffahren auf die Autobahn immer “Wenn wir auf dieser Fahrt sterben, dann sollst du wissen, dass ich Dich sehr liebe”. Dieses Ritual hatte manchmal etwas Komisches und manchmal etwas Bedrückendes. Es ist besser geworden, ich sage das nicht mehr so oft, aber die Idee, dass Dinge unausgesprochen oder ungeklärt bleiben, ist für mich ein Albtraum.
Als mein Vater anfing, mit einem seltsamen Husten herumzulaborieren, habe ich ihm immer wieder gesagt, wie wichtig es mir ist, dass er mir etwaige Diagnosen, egal wie vernichtend sie auch sein mögen, sofort mitteilt, damit ich Abschied nehmen und Dinge bereden kann. Jeder Mensch hat Dinge mit seinen Eltern zu bereden, bei mir war es die Zeit meiner Pubertät. Ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich die Kraft aufgebracht hätte, ihm zu sagen, wie es sich wirklich angefühlt hat, unter einem so dominanten Vater groß zu werden, dem man auf so schwierige Weise auch noch so ähnlich ist. Aber ich hätte die Option haben wollen.
Mein Vater hat letztlich trotz meiner Bitte einen anderen Weg gewählt und uns erst informiert, als es gar nicht mehr anders ging, obwohl er die Diagnose schon einige Zeit vor jenem besagten Dienstag bekommen hatte. Ich habe meinen Frieden mit seiner Entscheidung gemacht, aber dieses Gefühl, mir nahestehenden Menschen noch schnell etwas sagen zu müssen, weil es sonst jede Sekunde zu spät sein kann, ist geblieben.
Die stärkste Veränderung aber, die sich am meisten auf mein tägliches Leben ausgewirkt hat, war die Entwicklung einer ausgeprägten Hypochondrie.
Ich hatte immer eine robuste Gesundheit und viel Vertrauen in meinen Körper. Krankheiten habe ich mir nie eingebildet und ich habe auch nie unter Todesangst gelitten. Das änderte sich nach den gemachten Krebserfahrungen. Diese Veränderung setzte erst mit großer zeitlicher Verzögerung nach dem Tod meines Vaters und der Krebsdiagnose meiner Mutter ein, etwa im Frühsommer 2011.
Ein Husten war nicht mehr nur ein Husten, sondern ein fortgeschrittenes Lungenkarzinom.
Eine leichte Konzentrationsschwäche war keine Zerstreutheit, sondern ein inoperabler Gehirntumor.
Eine Unregelmäßigkeit in der Verdauung war Darmkrebs.
Ich war davon überzeugt, dass ich innen drin vollgestopft bin mit Metastasen. Dass ich jeden Krebs habe, den man sich nur vorstellen kann.
Jeden Tag musste ich gegen Panikattacken angehen, musste mir selber laut sagen, dass das alles Blödsinn ist. Ich bin noch nie bei so vielen Ärzten gewesen wie in den Sommermonaten 2011. Hautscreening, Koloskopie, Mammographie, Bluttests, ich habe alles machen lassen. Die Untersuchungen (sie waren natürlich alle negativ) machten es ein bisschen besser und ganz langsam, in winzig kleinen Mauseschrittchen erkämpfte ich mir mein Vertrauen in meinen Körper und meine Gesundheit zurück. Es ist besser, ich habe es im Griff, aber wie früher ist es nie wieder geworden.
Als ich mir letzte Woche einen Magen-Darm-Virus eingefangen habe, lag ich am Dienstag mit Fieber flach. Ich bekomme nie Fieber, nie, und sofort merkte ich wieder, wie diese hässlichen kleinen Trolle aus meiner Kehle heraufkrabbeln, um mir zu sagen, dass ich in 2 Wochen tot bin. Ich habe mittlerweile eine gewisse Routine darin, die Trolle im Zaum zu halten, aber es ist immer Anstrengung, ich muss immer darum kämpfen, keine Todesangst zu bekommen.
Was sich ebenfalls geändert hat, ist die Rückkehr zu mir selbst. Das Aufgeben jeglicher Masken.
Im Angesicht des Todes, wenn einem einer der wichtigsten Menschen entrissen wird und die ganze Welt wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt, wird einem die eigene Verletzlichkeit so brachial vor Augen geführt, dass jeder Versuch, den Schmerz zu kaschieren, zum Scheitern verurteilt ist. Ich brach zusammen. Mit allem, was ich davor war und sein wollte. Die kantige Selbstschutzfassade, die ich mit mir herumtrug, klappte zusammen wie ein Kartenhaus. Die Coolness, die Souveränität, das Gefühl, die Kontrolle über mein Leben zu haben, all das löste sich in Rauch auf. Ich habe mich noch nie so nackt und so hilflos gefühlt wie in den Monaten nach diesem doppelten Schicksalschlag. Früher war ich stolz darauf, niemanden zu brauchen, und Menschen um Hilfe zu bitten, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Ich kann alles und ich kann alles alleine, so war das.
Aber nachdem sich meine Welt in einen Albtraum verwandelt hatte, gab es nichts zu vertuschen: ich brauchte. Ich brauchte Menschen so dringend, ihr Verständnis, ihre Anteilnahme, ihre Zuneigung, ihr Verzeihen. Und wenn es überhaupt etwas Gutes an all dem gibt, dann vielleicht das. Ich kann heute Hilfe annehmen, ich mache nicht mehr alles mit mir alleine aus, ich glaube nicht mehr, dass ich niemanden brauche.
Ich brauche und das war vielleicht die beste Lektion in Demut, die mir der Tod meines Vaters beibringen konnte.
Ich habe gelernt, dass Trauer keinen Anfang und kein Ende hat, denn es ist tasächlich wahr: “Todd bädeittet Verränderruung!”

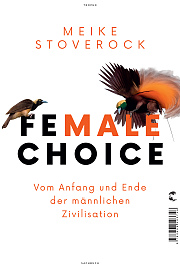



Meike,
danke! Hypochondrie. Ich stand aus ähnlichen Gründen kurz davor, mich komplett lächerlich und unglaubwürdig zu machen. Vor allem mir selbst gegenüber. Die Ärztin, der ich ein Klage wegen unterlassener Hilfeleistung angedroht habe tut mir heute noch sehr leid.
Gruß,
Alex
Der Tod ist ein Thema, über den in unserer Gesellschaft nicht viel und nicht gerne gesprochen wird, obwohl er jeden von uns betrifft. Das führt meiner Meinung nach dazu, dass wir so viele Probleme haben, mit der Trauer und mit der Akzeptanz der Veränderung. Und das ist das eigentlich Kranke an unserer Gesellschaft. Ich kann alles was Du schreibst sehr gut nachempfinden und damit meine ich jeden Satz. Dein Gefühl, Dinge an- und auszusprechen, bevor und weil es zu spät sein kann, ist eine sehr richtige und gesunde Einstellung. Nichts ist quälender als einem geliebten Menschen etwas nicht gesagt zu haben, was man unbedingt hätte mitteilen wollen. Zu dieser Einstellung bin auch ich erst durch entsprechende Erfahrungen gelangt. Ich teile Deine Hypochondrie und die Demut vor dem Leben und dem Tod. Ich stelle mir bei schwierigen Entscheidungen vor, was ich auf meinem Sterbebett sagen würde. Hätte ich bloß mehr gearbeitet, die Wohnung besser geputzt, mehr Geld gespart? Meine Erfahrungen mit dem Tod helfen mir meine Prioritäten zu erkennen und richtig zu setzen und letzten Endes mein Leben so zu leben, wie ich es wirklich möchte. Das war für mich mit großem Abstand die schmerzhafteste, aber auch die wichtigste Lektion, die mich das Leben gelehrt hat.
Tod bedeutet Veränderung, das stimmt, aber ob die Trauer keinen Anfang und kein Ende hat? Der Tod verändert unsere Beziehung zu dem Toten, denn diese besteht fort, auch nach dem Tod. Ich denke es geht beim Trauern vielleicht auch darum, diese Beziehung neu zu definieren und so lange uns das nicht gelingt, trauern wir.
In jedem Fall freue ich mich über Deinen offenen und ehrlichen Umgang mit diesem Thema. Danke dafür!
„Mortality“ gelesen? Von Hitchens: http://www.amazon.com/dp/1455502758
Ich noch nicht. Soll aber — dieses Thema behandelnd — sehr gut sein.
Ich freu mich sehr für Dich, dass Du brauchst!
.
liebe meike, … deshalb spreche ich bis heute mit meinem vater – auch wenn er schon seit `86 nicht mehr lebt. verstehende grüße und dank für dein offenheit ulla
.
Danke
Ähnliche Erfahrungen, gleiche Gefühle. Danke für das “in Worte fassen”.
Den Tod geliebter Menschen zu ertragen ist das Härteste, was wir erdulden müssen. Danach ändert sich alles. Du fasst das so beklemmend gut in Worte. Merkwürdigerwiese ist das ein Schmerz, der nicht hart, sondern weich macht. Und plötzlich kann man brauchen.
[…] Dinge, verändert “Todd bädeittet Verränderruung!” Ungemein berührender Text. Man kann nur hoffen, dass es einen selbst nie trifft, weiß aber doch, dass es unvermeidlich ist. […]