Unsere Sterbekultur ist eine Kultur des Festhaltens an Gefühlen und Erinnerungen. Sie akzeptiert nicht, dass jemand weg ist. Warum nicht mal loslassen?
Da ich in den letzten Monaten vor den Augen aller, die mir folgen, durch zwei sehr harte depressive Episoden gegangen bin, mag es den Einen oder die Andere besorgen, dass mein erster Text nach dieser schwierigen Zeit sich mit dem Tod befasst. Deshalb hier eine Entwarnung: Es geht mir deutlich besser (dass ich wieder schreibe, mag als Beweis herhalten), dieser Artikel ist keine düstere Vorausschau (oder gar Ankündigung) meines eigenen Todes, die Dinge sind so gut, wie sie es im Moment sein können. Es handelt sich nur um allgemeine Gedanken zur Sterbekultur, die ich mir in guten ebenso wie ich schlechten Zeiten immer mal wieder mache.
Diese Woche stolperte ich über einen Text im SZ Magazin, in dem eine Frau, eine trauernde Tochter, ihre Gedanken und Gefühle über den Tod ihres Vaters mit der Welt teilte. Der Text berührte mich, denn vieles an ihm erinnerte mich an den Tod meines eigenen Vaters: das Alter unserer Väter bei ihrem Tod, unser Alter als Töchter, die Todesursache Krebs und auch das Gefühl, bedeutungsvolle Momente mit dem Sterbenden für immer festhalten zu wollen.
Als mein Vater im November 2009 nach kurzer, schwerer Krankheit, wie man so schön sagt, seinem Lungenkrebs erlag, versuchte ich, meine Eindrücke in der letzten Woche vor seinem Tod irgendwie zu konservieren. Die Geräusche, Gerüche, die gesprochenen und die ungesprochenen Worte, die Gefühle. Gut zwei Jahre nach seinem Tod begann ich, Texte zu schreiben, die die letzten sieben Tage mit meinem Vater gewissermaßen runterzählten und mit dem Moment enden sollten, in dem sein Herz endlich aufhörte zu schlagen. Über mehrere Monate hielt ich die kostbaren und schrecklichen Momente fest, bis etwas Sonderbares passierte: Ich hatte keine Lust mehr, über meinen Vater zu schreiben.
Ich war nicht mehr traurig darüber, dass er nicht mehr lebte. Ich hatte keinen Schmerz mehr in mir. Ich war über seinen Tod hinweggekommen. Als meine Mutter, die zwischenzeitlich auch an Krebs erkrankt war, meinem Bruder und meinem Bruder und mir mitteilte, dass sie eigentlich nicht mehr wie ursprünglich geplant neben meinem Vater begraben werden wollte, war das für ihn ein Thema, für mich nicht.
Weiterleben, nicht vergessen
Erst nach und nach wurde mir klar, dass die unausgesprochene Prämisse westlicher Sterbekultur ironischerweise das Weiterleben der verstorbenen Person ist. Alles an Trauer ist darauf ausgerichtet, eine Leiche festzuhalten. Etwas soll lebendig bleiben, wir hängen Bilder der Verstorbenen auf, besuchen regelmäßig ihre Gräber, widmen ihnen Bücher, Dankesreden oder den Namen unseres Erstgeborenen. Wir führen unser Leben im Schatten eines Phantoms. Und dieses Phantom, ein Erinnerungsphantom, verhindert das Vergessen.
Eine tote Person wirklich loszulassen, im Frieden mit ihrer Nichtexistenz zu sein – das gestatten wir nur, wenn die tote Person ein Arschloch war. Wenn es Streit gab, Misshandlung oder andere Ungerechtigkeiten. Dann ist es in Ordnung, die innere Erinnerungsbrücke komplett abzubrechen. Wenn das Verhältnis gut oder auch nur normal durchwachsen war, sind Vergessen und Loslassen nicht vorgesehen.
Es liegt darin auch eine eigenartige Verleugnung der Realität. Natürlich wissen die meisten Menschen, dass eine Person nach ihrem Tod nicht mehr physisch da ist, aber die ultimative Akzeptanz, das Loslassen, vermeiden sie. Und verweigern sich damit dem Annehmen des Todes. Einer der abgedroschensten Sprüche über Trauer lautet “Es hört nie auf wehzutun, man lernt nur, mit dem Schmerz umzugehen”, und ich glaube, dieses Nichtverheilen ist das Resultat einer Trauerkultur, die uns nicht heilen lässt. Die von uns erwartet, dass wir für immer eine emotionale Verbindung zu einer verstorbenen Person behalten.
Warum “hört es nie auf wehzutun”? Warum können wir nur “lernen, mit dem Schmerz umzugehen”? Warum kann, darf, soll der Schmerz nicht aufhören?
Was ist Trauer?
Trauer ist zunächst ein nicht an Kultur gebundenes Gefühl. Verhalten, das man als Trauer deuten kann, findet sich bei vielen, vor allem intelligenten Arten, die soziale Bindungen eingehen. Totenwachen kennt man von Gorillas und Elefanten, die ein verstorbenes Gruppenmitglied über längere Zeit immer wieder besuchen und bewachen. Verstorbene Jungtiere werden, zum Beispiel bei vielen Walen und Primaten, von ihren Müttern noch eine Weile herumgetragen, bevor sie schließlich zurückgelassen werden. Und Haustiere reagieren oft depressiv, wenn ein Familienmitglied, mag es menschlich oder tierisch sein, stirbt. Meine eigene Katze schreckte nach dem Tod meines Katers monatelang auffallend häufig aus Albträumen auf, verlor Gewicht und forderte extrem viel Aufmerksamkeit von mir ein. Wo also Lebewesen Gefühle zu einem anderen Individuum empfinden können, da ist auch emotionaler Stress, wenn dieses Individuum stirbt.
Bei uns Menschen ist Trauer aufgrund unserer Intelligenz komplexer.
Wenn wir sagen, wir weinen um die Toten, wir betrauern ihr Schicksal, dann klingt das selbstloser als Trauer ist. Denn menschliche Trauer ist ein sehr ich-bezogenes Gefühl, unsere eigenen Bedürfnisse und ihre (zukünftige) Nichterfüllung sind das Wesen von Trauer.
Dabei geht es vor allem um Verlust. Vordergründig natürlich um den Verlust einer Verbindung, die uns viel bedeutet hat und auf die wir nun verzichten müssen. Alles, was wir an einem Kontakt geschätzt haben, fällt nun weg, unser emotionales Bedürfnis, das dieser Kontakt erfüllt hat, wird von nun an unerfüllt bleiben. Wir empfinden Leere.
Doch dahinter steht ein Verlust, der viel schrecklicher ist als alles andere: der Verlust von Kontrolle. Aus meiner Erfahrung heraus würde ich so weit gehen zu sagen, dass nichts Menschen so sehr an den Rand zivilisatorischer Errungenschaften bringt wie Kontrollverlust und Ohnmachtsgefühle. So grauenvoll ist dieses Gefühl, dass Menschen sogar töten, um ihm zu entgehen.
Der Tod einer nahestehenden Person katapultiert uns hinein in eine säuglingsähnliche Ohnmacht. Egal, wie sehr wir strampeln und schreien: Nichts kann das schreckliche Ereignis und den Verlustschmerz beseitigen. In diesem Punkt ähnelt Trauer dem Liebeskummer. Wenn eine andere Person unsere Gefühle nicht (mehr) erwidert, dann ist uns jede Kontrolle genommen, die Situation zu beeinflussen. Das ist für die meisten Menschen nur sehr schwer auszuhalten. Und so kämpfen sie innerlich gegen den Kontrollverlust, sie leisten emotionale Gegenwehr, um nicht akzeptieren zu müssen, dass sie hilflos sind.
Unsere Trauerkultur mit ihrem Festhalten an Erinnerungen ist (auch) Ausdruck dieser inneren Gegenwehr.
Kulturelle Altlasten
Was unsere menschliche Trauer so vielschichtig macht, ist neben unserem komplexeren Gehirn auch der Umstand, dass wir in einer selbstgeschaffenen Kultur leben, die auf uns zurückwirkt.
Da ist zum Einen das Leben in der patriarchalen Kernfamilie.
Solange die Menschen noch nomadisch lebten, gab es weder Privathaushalt noch Kernfamilie. Alle waren Teil eines Kollektivs, in dem alle einander gleichermaßen brauchen. Schutz, Erziehung und Ausbildung der Kinder war die Aufgabe aller, wodurch ein Netzwerk aus verlässlichen Bezugspersonen entstand.
Mit der Entstehung des Privathaushaltes schrumpfte die Welt der Kinder und mit ihr auch die Anzahl der Bezugspersonen extrem zusammen. Statt auf die gesamte Gruppe fokussierten sich menschliche Gefühle nur noch auf die im gleichen Haushalt lebenden Blutsverwandten. Der Einfluss der Eltern auf die Kinder dürfte dadurch ebenso zugenommen haben wie die Stärke und Tiefe der emotionalen Bindung.
Wenn aber die emotionale Welt der Menschen statt einer größeren, durch ein Wir-Gefühl zusammengehaltenen Gruppe nur noch wenig Menschen umfasst, wird der Verlust eines dieser Menschen als viel traumatischer und bedrohlicher wahrgenommen. Damit entsteht überhaupt erst die Grundlage einer Trauerkultur, die das Wegsein eines Menschen nicht akzeptieren kann (und will). Dass mit der Kernfamilie auch eine generationenübergreifende Verbindung und Verpflichtung einhergeht, wir also auch als Erwachsene noch Kontakt zu unseren Eltern haben, kommt verstärkend hinzu.
Auf die patriarchale Kernfamilie sattelt direkt die Religion auf. Vor allem die Monotheismen zeichnen sich durch sehr ausgeprägte Jenseitsvorstellungen aus und suggerieren damit, dass eine verstorbene Person in Wirklichkeit gar nicht ganz weg ist. Das nordische Walhalla ist eine Art Ruhmeshalle für im Kampf gefallene Männer, das Nirwana in Buddhismus und Hinduismus ist gleichermaßen das Ende allen physischen Seins wie auch ein temporärer Zwischenstopp zwischen zwei Inkarnationen.
Im Gegensatz dazu wirken monotheistische Jenseitsvorstellungen sehr konkret Man kann sich einen Ort vorstellen, an dem es der verstorbenen Person gut geht. Das Jenseits rückt den Menschen in die Nähe der männlichen Entität, die wir Gott nennen. Wenn ein Mensch stirbt, “kommt er in den Himmel”, “er sieht von oben alles”, “ist er immer bei uns”. An die Stelle eines absoluten Vergehens, wie in den asiatischen Religionen, tritt ein lebender Toter, ein Toter, der trotzdem irgendwie weiter existiert, weiter fühlt, uns weiter beobachtet.
Wie soll man denn die Nichtexistenz eines nahestehenden Menschen akzeptieren und alle Gefühle zu ihm überwinden, wenn er auf diese Weise auch nach seinem Tod ständig um uns herumscharwenzelt? Unser Geist akzeptiert den Tod, aber unser Gefühl bleibt lebendig. Es muss ja geradezu lebendig bleiben, wenn man davon ausgeht, dass “etwas” noch in unserer Nähe ist – alles andere wäre ja wie Verrat an der verstorbenen Person.
Darüber hinaus ist der Mensch gottgleich, er wurde von Gott nach seinem Abbild geschaffen. Jeder Mensch, vor allem jeder Mann, trägt demnach etwas Göttliches in sich. Aufzuhören, an den verstorbenen Menschen zu denken, ihn zu lieben, sein Andenken lebendig zu halten, kommt daher einer Abkehr von Gott gleich. Absolut undenkbar in Kulturen, in denen der monotheistische Einfluss jahrhundertelang so groß war wie in der Levante und Europa.
Auch wenn der Einfluss der Religion heute ein anderer ist, haben sich wesentliche Teile unserer Kultur an religiösen Werten, Dogmen und Regeln entlang entwickelt. Diese spiegeln sich bis heute nicht nur in unserem Umgang mit dem Tod, sondern unter anderem auch in der Sexualmoral und der Eheinstitution.
Den Rest der Wegstrecke übernimmt dann eine Welt, die Funktionieren über Fühlen stellt. Vor allem seit der Industrialisierung steht das Funktionieren in einer (kapitalistischen) Arbeitswelt im Vordergrund. Während unsere Empfindungen immer vielschichtiger (und damit störungsanfälliger) wurden, nahm der Druck zu funktionieren zu. Wir hatten kaum Gelegenheit, uns mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen.
Als Soldaten im Ersten Weltkrieg mit dem Kriegszittern (‘shellshock’) eine neurologische Schutzreaktion auf die schwer traumatisierenden Kriegserlebnisse zeigten, wurden sie zwar in psychiatrische Anstalten gebracht, dort aber nicht etwa tehrapiert oder geheilt, sondern zum Teil durch Konditionierung möglichst schnell wieder einsatzfähig gemacht. Die Lobotomie, das gezielte Durchtrennen von Nervenbahnen im Gehirn durch die Augenhöhle, diente bei einer Vielzahl von psychischen Störungen dazu, die vor allem für Bewusstsein und Reizreaktion verantwortlichen Gehirnareale zu zerstören und Opfer (sic!) so wieder funktionsfähig zu machen. Das sind natürlich besonders extreme Beispiele, aber sie zeigen die Prioritäten eines Systems, in dem Menschen und Menschlichkeit nicht genug Raum bekommen.
Auf unseren Umgang mit dem Tod übertragen bedeutet das, dass wir gar nicht lernen, den Schmerz der ultimativen Todesakzeptanz auszuhalten. Verdrängen ist viel einfacher. Und was hülfe besser beim Verdrängen als sich die Finger in die Ohren zu stecken und laut “Lalala” zu singen? Nichts anderes ist das beinahe zwanghafte Lebendighalten eines Verstorbenen. Wir umgeben uns mit Memorabilien, weil sie uns helfen, die Illusion aufrechtzuerhalten, die verstorbene Person sei nicht ganz weg.
Dieser letzte Punkt – Funktionieren über Fühlen – ändert sich zum Glück ganz langsam. Unser Bewusstsein für psychisches Befinden wächst, psychische Erkrankungen sind heute nicht mehr ganz so stigmatisiert wie früher und Gefühlen wird mehr Raum gegeben. Natürlich ist die “Früher war alles besser”-Fraktion noch sehr lautstark. Wenn heute über die neue Wehleidigkeit und Übersensibilität junger Menschen geklagt wird, dann ist damit nicht weniger gemeint, als dass wir zurückkehren sollen zum reinen Funktionieren. Zähne zusammenbeißen, Arschbacken zusammenkneifen, sich zusammenreißen. Nicht so viel Aufmerksamkeit auf das Fühlen richten. Aber vor allem jüngere Menschen nehmen sich mehr und mehr das Recht heraus, ihre Prioritäten anders zu setzen. Und damit besteht die berechtigte Hoffnung, dass auch ihre Fähigkeit, mit negativen Gefühlen umzugehen, wächst.
Ruhe im Frieden
Mein Vater war vielleicht die wichtigste Person in meinem Leben, sein möglicher Tod über viele Jahre mein ganz persönliches worst case scenario. Viele Eigenschaften, die ich an mir mag, habe ich von ihm, und ich verdanke ihm die schönstmögliche Kindheit. Es ist mir wichtig, das zu betonen, denn ich habe ihn nach seinem Tod nicht deshalb losgelassen, weil wir uns spinnefeind waren oder er mir irgendetwas angetan hätte, das über menschliche Fehler hinausging.
Ich habe ihn losgelassen, um frei zu sein. Frei von dem Gewicht eines Toten, dessen Meinung mich nicht länger beeinflusst. Weder positiv noch negativ. Frei auch von der Macht, die er im Leben über mein Empfinden hatte. Alle Eltern und gegebenenfalls auch Geschwister haben diese Macht über uns – bis in unser Erwachsenenalter hinein. Das ist eben die Nebenwirkung der Kernfamilie. Wir streben danach, von unseren Eltern Anerkennung und Liebe zu bekommen, wir empfinden Geschwister als Konkurrenz, wir richten uns bei der Wahl von Partnerinnen und Partnern nach dem, was wir in unserer Herkunftsfamilie als Liebe kennengelernt haben. Der familiäre Einfluss auf unser Empfinden kann verschiedene Gesichter haben, sowohl bereichernde als auch solche, die uns quälen, aber da ist er immer.
Meinen Vater loszulassen, war keine aktive oder bewusste Entscheidung, es passierte einfach. Vielleicht, weil ich schon immer einen etwas anderen Blick auf den Tod hatte als die anderen Kinder. Als ich merkte, dass ich die Artikelserie über die letzten sieben Tage meines Vaters nicht mehr weiterschreiben wollte, weil ich einfach nicht mehr genug emotionalen Bezug zu seinem Tod hatte, da habe ich … was empfunden? Scham? Ein schlechtes Gewissen? Ja, ich glaube, irgend so etwas war es. Dass wir aufhören zu lieben und zu leiden, ist nicht vorgesehen.
Es hört nie auf wehzutun, man lernt nur, mit dem Schmerz umzugehen, nicht wahr?
Falsch. Man kann die Toten tot sein lassen, man kann ihre Nichtexistenz akzeptieren, man kann aufhören, Schmerz zu empfinden. Wenn man die ganzen kulturellen Altlasten überwindet und sich selbst das Nichtfühlen erlaubt, dann fühlt sich das ziemlich gut an. Und vor allem ziemlich frei.


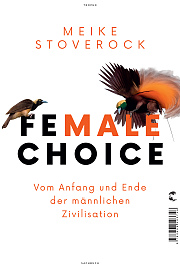



Wunderbar formuliert. Es geht, wie so oft, um die Freiheit zu empfinden was man wirklich fühlt. Irgendwann ist mal gut, und man sollte die Toten ruhen lassen. Bei den Tibetern im alten Bön Buddhismus muss man die Toten loslassen, sie wurden früher den Geiern verfüttert, und Andenken an sie waren verpönt. Klingt in unseren Ohren gruselig… aber so ist es eben. Das Leben geht weiter, ohne einen.
Unverschämtheit ;-)
Danke, liebe Meike, für diesen persönlichen Text, der sehr präzise formuliert, wie auch ich über den Umgang mit Toten denke. (Zum Glück übernimmst Du das Formulieren immer für mich. Bei mir ist bei solchen Themen zwar Klarheit im Herzen, aber diffuser Nebel im Kopf.) Nach dem Tod meines Vaters habe ich acht Seiten Brief an seine Studienfreundin gebraucht, um an den Punkt zu kommen, an dem Du dann auch irgendwann angelangt bist. Meine Mutter hat stattdessen sein Foto ins Bücherregal gestellt. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn ich es sehe.
Das Einzige, was mir ein bisschen in Deinem Text fehlt, ist dieses Biologische beim Tod des eigenen Kindes. Ich denke einerseits zwar, dass dabei die gleichen Trauerprinzipien gelten sollten wie im Text beschrieben, aber andererseits ist für eine Mutter das eigene Kind auch ein Teil ihres Körpers. Und das ist/wäre ein Verlust, den ich als Mann z.B. nicht genauso nachempfinde, wie es die Mutter tut/tun würde, vermute ich.
Deine Texte machen dem Leser immer wieder die Wichtigkeit dieser “Freiheit VON” bewusst. Inzwischen denke ich, dass wir in unseren westlichen Gesellschaften die “Freiheit ZU” viel zu lange schon überbewerten, anstatt uns mal intensiv um die “Freiheit VON” zu kümmern.
Ein sehr schönes Buch der Reihe “Naturkunden” zum Thema Tod ist “Leben ohne Ende. Der ewige Kreislauf des Lebendigen” von Bernd Heinrich (2019), das die Verbundenheit eines einzelnen Lebens mit dem ökologischen System der Erde auch nach seinem Tod beschreibt und für ein zu Ende gehendes individuelles menschliches Leben als sinnvoll und sinnstiftend begreift. Und die Szene aus “Black Robe – Am Fluss der Irokesen” (1991), als sich der Häuptling der Huronen zum Sterben auf eine Insel begibt (anstatt den Ideen des jesuitischen Missionars zu folgen), ist wie eine Ankündigung eines dritten Wegs der ökologischen Beerdigung: Promession / Promation / Recompose. Dieser Weg der Beerdigung würde den Ideen einer solchen “neuen” Sterbe- und Trauerkultur gut entsprechen und wäre eine weitere konkrete Möglichkeit von Veränderung.
“Das Einzige, was mir ein bisschen in Deinem Text fehlt, ist dieses Biologische beim Tod des eigenen Kindes.” Das gleiche dachte ich auch beim Lesen dieses Textes, dem ich ansonsten in jedem Punkt zustimmen kann. In meinem Bekannten- und Freundeskreis ist dies zwei Elternpaaren zugestoßen, und ich verstehe vollkommen, wenn eine der zwei Mütter noch nach 20 Jahren sagt “Es hört nie (ganz) auf, wehzutun.”
Ich gehöre keiner Religion an, aber wenn ich mal so etwas wie eine Bitte an “das Universum” bzw. an alle “Göttinnen und Götter, Ahnen, Verbündeten und wer sonst noch in irgendwelchen Sphären unterwegs sein könnte” sende, dann ist es die, mich bitte vor meinen Kindern sterben zu lassen!
Als mein Erstgeborener mit drei Jahren lebensgefährlich erkrankte, saß ich in einer Hütte in Indien an seinem Bett und habe den o.g. Wesenheiten folgendes “erklärt”: Da ich verantwortlich dafür bin, dass mein Kind hier – fernab von jeder modernen medizinischen Versorgung – um sein Leben kämpft, werde ich Selbstmord begehen müssen, falls er stirbt. Wenn Ihr also findet, meine Zeit sei noch nicht gekommen, dann müsst Ihr zuerst ihn retten!
Mein Sohn wurde wieder ganz gesund; bis heute denke ich, dass wir dem Tod damals sozusagen gemeinsam von der Schippe springen durften.
Dass die eigenen Eltern (oder auch Großeltern) irgendwann – vor einem selbst – sterben, ist der “natürliche”, erwartbare Lauf der Dinge; und dass die anfängliche Trauer mit der Zeit abebbt, empfinde ich als ebenso “normal”. Dass ein Kind oder ein*e Jugendliche*r stirbt, ist jedoch ein Horror-Szenario für alle liebenden Mütter und Väter, ein kaum zu bewältigender Schmerz und in gewisser Weise auch ein Verstoß gegen unsere eigene Natur.
Denn wie bei allen Arten von Lebewesen ist unser wichtigster, evolutionär verankerter biologischer Auftrag ist nun einmal der Fortbestand der eigenen Art – was beim Homo Sapiens weit über simple Reproduktion hinausgeht, weil dessen hilflosen, “unfertigen” Nachkommen auch nach der Geburt noch viele Jahre lang auf die Fürsorge der Mutter – und im Idealfall auch des Vaters – angewiesen sind.
Noch eine Geschichte fällt mir dazu ein: Mit meiner fast 90jährigen Großtante konnte ich – damals noch eine junge Mutter – ungewöhnlich offene Gespräche über Alter, Krankheit und Tod führen.
Sie hatte zwei Weltkriege überlebt, zweimal wieder bei Null anfangen müssen, immer hart gearbeitet und ein eher bescheidenes Leben (ohne Urlaube oder andere, für mich selbstverständliche Annnehmlichkeiten) geführt.
Trotzdem sagte sie, sie sei zufrieden, denn sie habe ein “gutes Leben” gehabt. Aber nun, da ihr Körper immer hinfälliger werde, sie kaum noch laufen könne und bei den einfachsten Dingen auf Hilfe angewiesen sei, könne “auch langsam mal Schluss sein”. Ein Vierteljahr später ist sie dann auch gestorben.
Doch dann fügte sie noch etwas hinzu: “Das einzige, worüber ich nie ganz hinweggekommen bin, ist, dass ich Kurti verloren habe”. Und sie fing an zu weinen – und ich auch.
Kurt war ihr gerade mal 20jähriger Sohn gewesen, der 1944 an der sog. Ostfront “gefallen” (was für ein erbärmlicher Euphemismus für “erschossen” oder “von Granaten zerfetzt”!) war.
Liebe Meike, liebe Leser:innen,
vielen Dank für die Mühe, diese Gedanken aufzuschreiben, Persönliches offen zu legen, den Mut, selbst die “heiligsten” (aka: die zivilisatorisch festgeschriebensten) Dinge zu hinterfragen.
Schon seit Jahren stelle ich immer wieder verblüfft fest, dass es eine große Unsicherheit im Umgang mit all den großen Lebensmomenten gibt: Geburt, Hochzeit, schwere Krankheit – und ja, auch Tod.
Gerade so, als wüsste der “unzivilisierte” Kern in uns, dass das zivilisatorische Pflaster nicht wirklich hilft, darunter etwas Unaussprechliches, nicht Beeinflussbares liegt. Und so findet sich auch amüsanterweise bei diesen Anlässen immer eine Flut ungefragter Meinungen von Menschen – die alle in die Richtung weisen, wie man sich jetzt richtig zu verhalten hätte / das am Ende alles gut wird. Und dabei so klingen, als würden diese Menschen das mehr zu ihrer eigenen Beruhigung sagen, das Wiegenlied der Zivilisation singen.
Und was das Funktionieren angeht – haben wir WEIRD Menschen vielleicht auch deshalb so einen kruden Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Weil wir nicht verstehen, wie jemand existieren – aber dabei nicht 100% funktionieren kann?
Und ja, ich freue mir auch jedes Mal ein Loch in den Bauch, wenn meine knapp 30-jährigen Kollegen einen “business-call” in aller Selbstverständlichkeit mit einem ernst gemeintem “hey, wie geht’s Dir grad mit der Aufgabe?” beginnen. Counsellor Deanna Troi sitzt schon selbstverständlich auf der Brücke ;D
Liebe Grüße,
Su