Wochen der Dunkelheit liegen hinter mir. Zeit für etwas Leichtes, Erbauliches. Zum Beispiel “Das Hotel New Hampshire” von John Irving
Altes Papier, Papier, das viele Male berührt wurde, verändert sich. Wenn man oft genug mit dem Finger über die Ecke eines Blattes Papiers streicht, wird es geschmeidig und faserig. Rasiermesserscharfe Kanten werden weich. Wäre es Stoff, würde man sagen, es franst aus. Die Haptik wird tröstlich wie ein Schnuffeltuch.
Ich sitze im Zug und lese. Meine Finger spielen unbewusst mit den Zipfeln zweier fehlerhafter Seiten. Welcher Prozess beim Bücherfertigen es auch immer war, der schiefgelaufen ist: zwei Seiten des Buches haben keine gerade Kante, sondern einen unregelmäßigen Überstand. Beim Lesen fummele ich daran und obwohl ich mit Gedanken, Gefühlen ganz bei dem Inhalt des Textes bin, höre ich einen Teil meines Gehirns sagen, reiß den Zipfel ab. Immer wieder stört mich die Stimme beim Lesen, es ist vollkommen klar: eine Entscheidung muss her. Abreißen oder nicht. Ich klappe das Buch zu, den Finger als Lesezeichen zwischen den Seiten, und überlege zum Fenster des fahrenden Zuges hinaus. “Das Hotel New Hampshire” von John Irving. Ein Buch voller Macken, voller Schrullen, voller seltsamer Personen und Begebenheiten.
Da ist der alte Bär State o’ Maine, der nichts anderes als “Earl” sagen kann. Da ist Lilly, die irgendwann einfach nicht mehr weiterwächst und deshalb eine große Schriftstellerin wird. Da ist der homosexuelle Frank, der ein Gespür für Uniformen, Taxidermie und den österreichischen Kronprinz Rudolf hat. Da ist Iowa-Bob, der Großvater mit einem Gespür für Hanteln. Freud, der Besitzer von State o’ Maine, der eigentlich anders heißt, aber weil er Österreicher und Jude ist und alle österreichischen Juden bekanntlich Freud heißen, von allen Freud genannt wird. Da sind Franny und John, sie mit einem Gespür für Stärke, er mit einem Gespür für Franny, die seine Schwester ist. Da ist Susie, Freuds zweiter Bär, der gar kein Bär ist, sondern ein hässliches Mädchen ohne Gespür für Menschen. Sie hat auch ein Gespür für Franny. Da sind Mutter und der kleine schwerhörige Egg, die beide ein tragisches Gespür für den kalten Atlantik haben. Da sind die Huren, Kreisch-Annie, die Alte Billig, Jolanta, die Kampfmaschine, und Babette. Und die Dunkle Inge, aber die darf man nur anschauen, nicht anfassen. Da sind die Radikalen, ein Trupp Umstürzler, die ein Gespür für Revolution haben und den ganzen Tag wütende Pamphlete in ihre Schreibmaschinen hacken. Und da sind jede Menge Hotels. Das erste (in New Hampshire), zweite (in Wien) und dritte (in Maine) Hotel New Hampshire, außerdem noch das Stanhope (in New York) mit einem Gespür für Racheakte.
Mit süßen Zwanzig habe ich das Buch zum ersten Mal gelesen und als ich es vor ein paar Tagen erneut aus meinem Buchregal zog, da hatte ich nicht mehr viel davon im Gedächtnis. Eigentlich haben mich nur die Radikalen mein Leben lang als Thema begleitet. Als ich während meines Studiums mit B. in einer WG im fünften Stock eines Hamburger Altbaus wohnte und wir eines Tages über uns, wo nur der Dachboden war, Geräusche von Menschen hörten, erzählte ich ihr die Geschichte von den Radikalen, die wahrscheinlich da oben säßen und den Umsturz planten. An Wien erinnerte ich mich also, an die Radikalen, aber sonst blieb nicht viel. Außer einem Gefühl. Ein Gefühl, das ich weder vor dem Hotel New Hampshire noch danach je wieder bei einem Buch hatte: Als ich das Buch ausgelesen hatte, wurde mir das Herz so entsetzlich schwer, weil ich das Gefühl hatte, mich für immer von wirklich guten Freunden verabschieden zu müssen.
Zu beschreiben, was “Das Hotel New Hampshire” ist, ist ungefähr so unmöglich wie zu beschreiben, was eine Meeresbrise ist. Wenn man sagt, eine Meeresbrise sei bewegte Luft, dann stimmt das zwar formal, aber man erfährt nichts über den Geruch nach Salz und verfaulendem Tang, über Gefühle von Freiheit und Sehnsucht, über die Demut vor der eigenen Kleinheit im Angesicht der Gezeiten. “Das Hotel New Hampshire” als die Geschichte einer Familie, die über knapp dreißig Jahre in verschiedenen Hotels lebt, zu beschreiben, ist ebenso formal richtig, unterschlägt aber alles, was man wissen muss.
“Das Hotel New Hampshire” ist auch eine Geschichte über Liebe, Gewalt, Rache, Sex, Inzest, Suizid, über ein universelles Gleichgewicht, das alles irgendwie in der Waage hält, Antisemitismus, Feminismus und darüber, dass Hilflosigkeit auch etwas ungeheuer Würdevolles haben kann. Genauso wie Sehnsucht. Darüber, wie stark die Anerkennung der eigenen Beschränkungen ist.
Einige mysteriöse Begegnungen mit einem Antisemiten in weißer Smokingjacke, einem Bär namens State o’ Maine und seinem Besitzer Freud wecken in dem (späteren) Ehepaar Berry das Gespür für Hotels. Ausgerüstet mit fünf Kindern (aufsteigend: Egg, Lilly, John, Franny, Frank) funktionieren sie also zunächst die leerstehende Mädchenschule in Dairy, New Hampshire, um und reden sich ein, dass es doch ganz okay läuft. Aber es läuft nicht okay. Franny wird von den Bullies vom Footballteam vergewaltigt, weder John noch Frank können es verhindern (oder wenigstens rächen), das Hotel steht mehr leer als voll, der alte Familienhund Kummer stinkt flatulierend vor sich hin und als Frank ihn nach seinem Dahinscheiden ausstopft und der ausgestopfte Hund unvorbereitet aus des Großvaters Schrank kippt und Großvaters Herz vor Schreck kurzentschlossen aufhört zu schlagen, bricht irgendwie die Realität in ihr Leben ein. Doch da kommt Post aus Europa: Von Freud, der mittlerweile ein Hotel in Wien betreibt, das zur aufgerundeten Hälfte von Huren, zur aufgerundeten Hälfte von Radikalen und zu den an einhundert fehlenden Prozenten von tatsächlichen Gästen bewohnt wird. Und so macht sich die Familie Berry auf den Weg nach Wien, um Freud mit seinem Hotel zu helfen. Sie finden eine Art von Liebe, vereiteln die Sprengung der Staatsoper, Franny findet ihre Singstimme, Vater Berry verliert seine Weitsicht, Freud sein Leben und als sie schließlich zurückkehren nach Amerika, ist niemand mehr, wie er war, und doch genau so.
Die Melancholie ist auf jeder Seite des Buches dabei, doch John Irving geht nie über ein Seufzen hinaus. Ein Luftholen, ein kurzer Moment der Fassungslosigkeit, als ob einem jemand kurz ins Herz kneift, wenn der Tod zuschlägt, die Gewalt einbricht in diese kleine, entzückende, schrullige, liebenswürdige Welt. Aber noch bevor die Tränen Wasser werden können, wandelt sich die Melancholie in frivolen Aberwitz.
John Irvings Buch ist ein Fest der Lebenslust, ohne Leben zu predigen. Es ist von der ersten bis zur letzten Seite ein unbekümmertes Schulterzucken, ein furchtloses Annehmen sowohl der schönen als auch der schlimmen Ereignisse. Keine der Besonderheiten der Familie Berry, Kleinwuchs, Homosexualität, Schwerhörigkeit, Gewalterfahrung, ist wirklich etwas Besonderes. Diese Eigenheiten, die die Familie zu von der Gesellschaft Ausgestoßenen machen könnten, sind nur eine andere Art der Normalität.
Die hinreißende Gleichgültigkeit aller Personen gibt der Geschichte Leichtigkeit. Große Gefühle, wie Trauer, Wut oder Angst, sucht man hier vergebens, sie sind einfach nicht im Repertoire der sturmerprobten Familie vorhanden. Wer schon einmal große Gefühle hatte, weiß, wie anstrengend die sein können, und so ist der Verzicht auf Drama gerade die Zutat, die die Geschichte so leicht macht. Wie ein rot-weiß geringelter Dauerlutscher oder Gras unter den nackten Füßen. Rot-weiß ist auch das Motiv, das über diesem verrückten, normalen, alle Absurditäten des Lebens umarmenden Trupp Menschlein schwebt – Blut und Schlagobers.
In den letzten Monaten habe ich oft alte Bücher aus dem Regal gezogen und noch einmal gelesen. Diese Bücherzeitreise war eine Maßnahme im Kampf gegen die Depression, aber ich fand es auch aufschlussreich, wie unterschiedlich Bücher mit einem Abstand von 25 oder 30 Jahren wirken. Und während einige heute im Vergleich zu der Wirkung, die sie damals auf mich hatten, geradezu blässlich schienen, wurde mir mit jeder Seite von “Das Hotel New Hampshire”, die ich ausgelesen hatte, mit jeder Seite, die der Rest des Buches dünner wurde, beklommener. Der Abschied rückt näher.
Da sitze ich also, schaue zum Fenster hinaus, den Finger immer noch als Lesezeichen zwischen den Seiten, und denke über das Buch nach. Ich glaube, wenn es jemals ein Buch gab, für das ein fehlerhafter Papierschnitt eine Zierde ist, dann muss es wohl dieses sein. Natürlich reiße ich die Zipfel nicht ab, ich lasse sie wie kleine schrullige Wimpel als eine Art Inhaltsangabe an diesem Buch.
Während die Landschaft draußen wie ein einziger Farbwisch an mir vorbeifliegt, steigen Tränen in meinem Hals auf. Alles an diesen Tränen ist richtig. Es sind Tränen der Liebe, der Freude, der Rührung, des bevorstehenden Abschiedsschmerzes. Aber ich sitze immer noch im Zug und auch wenn ich mich nicht schäme, in der Öffentlichkeit zu weinen, ist hier einfach nicht der Platz für eine Kernschmelze. Ich mache einen Knick in die Seite, klappe das Buch mit dem dünner werdenden Rest zu und hebe mir den Abschied für später auf. Später, wenn ich wieder so zuhause bin, wie ich mich in diesem Buch fühle.
Blut und Schlagobers sind keine schlechte Mischung für ein Leben, denke ich, und lächele aus dem Fenster, während eine Träne meine Wimperntusche ruiniert.


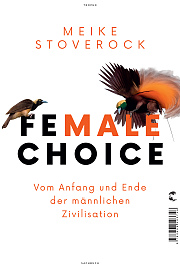



Irving hab ich irgendwann in den Neunzigern entdeckt, Hotel New Hampshire war eines der schönsten, die ich von ihm gelesen habe. Und erst viel später (nach dem Film “John Irving und wie er die Welt sieht”) habe ich verstanden, wie präzise, wie sparsam er das baute – und daß nichts, was in seinen Geschichten vorkommt, unnötig ist. The very idea, einen ollen stinkenden Hund “Sorrow” zu nennen, nur um dann nach zwei Dritteln des Buchs eine Katastrophe mit den lapidaren Worten “Sorrow floats” zu beenden – What The Dingens?
Und jetzt, nach Deinem Artikel, habe auch ich Lust, es noch einmal zu lesen – an die New-York-Episode kann ich mich nämlich überhaupt nicht mehr erinnern.