18. November 2009. Mittwoch.
Ein Termin beim Hausarzt. Das weitere Vorgehen soll besprochen werden. Außerdem müssen nochmal Medikamente gegen die Bronchitis abgeholt werden. Ich sage, ich gehe mit Mutti dorthin. Ich sage es, um ihr, um uns die Chance zum Reden zu geben. Sie ist seit Tagen mit dem Tod allein.
Mutti ist niemand, der Gefühle herauslässt. Sie möchte niemanden damit belasten, frisst alles in sich hinein. Das kann doch nicht gut sein, habe ich immer gedacht. Gesagt habe ich es nie. Wir gehen los. Zu Fuß und sie erzählt. Dass Vati geweint hat am Samstag. Zum ersten Mal in fast vierzig Jahren. Sie hat ihn vorher noch nie weinen sehen.
Mutti weint, als sie es erzählt. Wir setzen uns für einen Moment auf eine Bank. Wenn ich das gewusst hätte, dass ich mich mal so schwach fühlen würde, hat er gesagt. Er ließ den Kopf hängen und seine Schultern haben gezittert, sagt sie.
Das Schwachsein ist für ihn das Allerschlimmste, nicht der Tod. Vati war immer Anführer. Durchsetzungsstark, dominant, souverän. Immer souverän. Jemand, der immer die Kontrolle hat und niemandem vertraut, weil alle schwächer sind als er.
Es ist furchtbar für Dich, die Kontrolle abgeben und Deiner Familie vertrauen zu müssen, ich weiß.
Herr P. ist ein kleiner Mann, jung, maximal Anfang vierzig.
Er schaut mich an. Sein Blick ist ernst und besorgt und ungewohnt sanft. Ungewohnt für einen Arzt. Was sagen Sie zu Ihrem Vater, fragt er mich. Ich stammele irgendwas von großer Schock und schwer verdaulich.
Ich frage, wird er nochmal zunehmen? Herr P. sagt, nein. Das ist die Tumorauszehrung, sagt er, vielleicht kommt nochmal ein Kilo drauf, aber im Wesentlichen wird sich nichts mehr ändern. Ok, sage ich, also müssen wir ihn nicht ständig zur Nahrungsaufnahme überreden. Nein, sagt Herr P. Geben Sie ihm, worauf er Appetit hat, und wenn er nichts essen mag, üben Sie keinen Druck aus.
Ich bin erleichtert. Seit Mutti mir erzählt hat, wieviel Gewicht Vati verloren hat, ist mein einziger Gedanke, wie wir Kalorien in ihn hineinbekommen. Jeden Bissen, den er nicht isst, empfinde ich als Anklage. Da liegt der Bissen auf dem Teller und schreit mich an. Versagt, Du hast versagt.
Und wie lange noch, frage ich. Schwer zu sagen, sagt Herr P. Es kann sein, dass er sich nochmal ein bisschen bekrabbelt, dann dauert es etwas länger, es kann aber auch sein, dass der Tumor ihn jetzt einfach überrennt. Tage, maximal einige Wochen. Er bestätigt damit mein Gefühl der letzten Tage und für einen kurzen Moment ist Ruhe in mir. Gut, denke ich. Dann ist es schnell vorüber. Gut für ihn.
Herr P. sagt, wie es weitergeht.
Ein leichtes Beruhigungsmittel. Das schafft eine gesunde Distanz und hilft, Ängste zu lösen. Sie und Ihre Mutter können es auch nehmen.
Dann Morphium. Ich erschrecke. Hat er Schmerzen, frage ich. Nein, das Morphium macht, dass er etwas besser atmen kann und nicht so viel husten muss, sagt der Arzt.
Morphium. Zuerst kleine Ampullen zum Trinken, später kleine Ampullen zum Spritzen.
Später. Wenn das Schlucken schwerer wird. Wenn Du schwächer wirst. Wenn Du ohne Besinnung bist.
Und der Geruch, frage ich. Das ist auch der Tumor, sagt Herr P. Er wächst so schnell, dass die Blutgefäße mit der Versorgung nicht hinterherkommen. Teile des Tumors sterben ab.
Verfaulen. Er sagt es nicht.
Der Geruch, den wir wahrnehmen, ist der Geruch faulenden Fleisches. Mein Magen krümmt sich zusammen.
Keine Kraft zu schreien, keine Kraft zu weinen. Das Entsetzen ist so groß, dass es alles in mir lähmt. Betäubt. Ich spüre das Entsetzen, aber es ist das Entsetzen eines anderen. Ich spüre die Verzweiflung, aber es ist wie eine Erinnerung an Verzweiflung.
Es ist, als ob ich meine eigenen Gefühle wie durch eine Glasscheibe fühle. Als ob ich mir selber beim Fühlen zuschaue. Zombie. Autopilot-Zombie.
Vati nimmt die Medikamente nicht, als wir nach Hause kommen. Morphium, das ist das letzte Stück Wegstrecke, die Zielgerade, der Punkt ohne Wiederkehr, das endgültige Eingeständnis, wie auch immer. Es ist ein stiller Protest, es noch nicht zu nehmen. So schlimm ist es noch nicht.
Doch, es ist so schlimm. Der Husten lässt ihn nicht mehr zur Ruhe kommen, er schläft kaum noch. Tagsüber wirkt er matt und nachdenklich, niedergeschmettert. Ich möchte wissen, was er in diesen Momenten denkt, und möchte es doch nicht wissen.
Bereust Du etwas? Bist Du verzweifelt? Hast Du Angst? Bist Du wütend? Auf Dich selbst? Auf uns?
Ich will es nicht wissen.
Nimm die Medikamente. Bitte.
Nein, sagt er. Noch nicht.
Noch sechs Tage, dann bist Du tot.
Lieber Vater: Noch sieben Tage.
Lieber Vater: Noch sechs Tage.

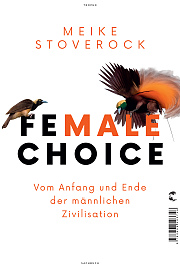



Sehr gut geschrieben. Es ist nicht so traurig dargestellet, wie es hätte dargestellt werden können. Nicht so traurig wie es ist?
Gänsehaut! Sicher umstritten diese Öffentlichkeit. Aber warum den Tod immer verstecken oder durch Hollywood inszenieren lassen?
Ich kenne diese Situation. Auch mein Vater hat Medikamente abgelehhnt und ist zu Hause gestorben. für mich war es grausam und schön zugleich. Schreiben hilft.
Hannes Wader sang ein Lied von Bell:
“Darfst nun getrost.”
http://www.youtube.com/watch?v=MTdLJY0OrOc
Hat mir sehr geholfen.
[…] Lieber Vater: Noch sechs Tage. – Fuck you, I’m human.. Dieser Eintrag wurde veröffentlicht in Allgemein von Jacek. Permanenter Link des Eintrags. […]
Der Text hat mich sehr bewegt, ich bewundere, dass du so darüber schreiben kannst. Danke dafür.
gefällt mir sehr gut. mein vater ist vor kurzem gestorben. es war vieles anders, aber die emotion “elternteil stirbt” hast du erwischt!
guter Schreibe – relevanter Inhalt
Stirb langsam, aber schnell, damit es nicht so weh tut – für keinen von uns beiden. Trösten kann mich keiner, aber ich bin froh, dass andere auch trauern und wegbegleiter sind. Danke an die die den Mut haben und nicht wegschauen.
*wow* es ist, als ob du über meine großeltern schreibst… mein opa ist gerade an krebs gestorben :(