Ein Text über psychische Gesundheit für Leute, die mit dem Thema nichts am Hut haben
Psychische Gesundheit wird mehr und mehr ein Thema für die Massenmedien; Podcasts, Artikel und Ratgeberliteratur erreichen zum Teil ein sehr großes Publikum, das daran interessiert ist, mehr über Depressionen, Burnout oder sich selbst zu erfahren. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, denn nur kontinuierliche Information hilft dabei, Vorurteile abzubauen und die Situation für Hilfesuchende zu verbessern.
Doch oft wird dabei über konkrete Diagnosen geschrieben und das erhöht die Hürde für Lesende zu erkennen, dass sie selbst womöglich psychische Probleme haben, unnötig. Das Befassen mit einer bestimmten Diagnose setzt ein Maß an Eigenbeschau voraus, das die meisten Menschen (noch) gar nicht haben.
Mögliche Erkrankungen (psychisch und körperlich) sind im International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD), einer Art Katalog mit Parametern zur Beschreibung und Diagnostik, festgehalten. Der Katalog ist international anerkannt, wird laufend aktualisiert und mit einer Versionsnummer versehen. Aktuell gilt der ICD-11.
Diagnose: Ich leide nicht, also bin ich nicht
Entscheidend sind bei der Definition psychischer Krankheiten mehrere Dinge.
1. Eine zeitweise oder plötzliche Veränderung in Verhalten, Wahrnehmung, Denken und Fühlen einer Person liegt vor. Eine Person denkt, handelt und fühlt in einem klar zum normalen Alltag abgrenzbaren Zeitraum anders.
2. Eine dauerhafte Abweichung von der durchschnittlichen Norm liegt vor. Eine Person denkt, handelt und fühlt dauerhaft anders als die breite Masse “gesunder” Menschen.
3. Die Person oder ihr Umfeld leidet: Die Veränderung oder Störung erzeugt einen Leidensdruck bei der betroffenen Person oder ihrem persönlichen Umfeld.
Das klingt alles erst einmal sinnvoll und nachvollziehbar – um einer Person zu helfen, muss man ja irgendwie wissen, was sie hat, und da scheinen objektive Marker sinnvoll. Aber wo es in der öffentlichen Berichterstattung um Krankheiten geht, fühlen sich vor allem Leute angesprochen, die a) ihren psychischen Zustand überhaupt auf dem Schirm, und sich selbst b) schon gefragt haben, ob das, was sie fühlen und denken schon Krankheitswert hat. Menschen, die die drei obigen Marker für sich verneinen, blättern womöglich weiter.
Gerade der Leidensdruck ist nicht immer gegeben, weil er sich allzu oft an der patriarchal-kapitalistischen Arbeitswelt der männlichen Zivilisation orientiert. Leidensdruck entsteht da, wo eine Person nicht mehr arbeiten kann. Wo sie den Alltag nicht mehr gebacken kriegt. Wer all das schafft, weil er oder sie eine Anpassungsfähigkeit bis an die Grenze der Selbstverleugnung hat, wird kaum jemals zu dem Schluss kommen, Hilfe zu brauchen – selbst, wenn er/sie unter der Oberfläche ständig belastet ist oder regelmäßig zu betäubenden Substanzen greift und von selbst nicht da herauskommt.
Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen können für Betroffene und ihr Umfeld bereits lange bevor sie nach der obigen Definition krank sind zu erheblichen Problemen führen. Und deshalb ist dieser Text vor allem für Menschen, die sich für gesund halten oder die sich noch nie Gedanken über ihr Denken, Fühlen und Verhalten gemacht haben.
Der schleichende Weg in die Krankheit
Ich schreibe hier als jemand, der langjährige Erfahrung mit psychischen Erkrankungen sowohl als Betroffene als auch als Angehörige von Betroffenen hat. Ich habe rezidivierende Depressionen, also Depressionen, die in mehr oder weniger regelmäßigen Schüben auftreten. Außerdem war ich mindestens zehn Jahre lange angstgestört. Und ich habe auf meinem Weg vor allem gemerkt, wie schleichend der Weg in eine psychische Erkrankung ist, wie unauffällig. Er ist so unauffällig, dass man sich und anderen das eigene Denken, Fühlen und Handeln als “So bin ich eben” verkaufen kann.
Wie viele andere Menschen auch kenne ich mich mit einem Satz an Charaktereigenschaften, die mich ausmachen. Dazu gehörte immer ein Hang zur Melancholie, ein Hang zum Grübeln, ein Hang zur Vermeidung, ein Hang zum Einzelgängertum und ein Hang dazu, Verantwortung für Schwächere zu übernehmen. Diese Eigenschaften lassen sich bis zu meinen Zeugnissen aus der Grundschule zurückverfolgen. Meine Anpassungsfähigkeit war dabei aber noch groß genug, damit ich nicht als schrullige Tante galt. Ich habe viele Jahre als Angestellte gelebt, ging jeden Morgen ins Labor und abends wieder nach Hause, habe Institutsfeiern mitgemacht, viele Affären und wenige Partnerschaften gehabt – kurz: ich habe soweit funktioniert, dass weder mir noch anderen auffiel, dass meine von mir als “so bin ich eben” wahrgenommenen Eigenschaften viele soziale Bindungen vergiftet haben.
Meine narzisstische Idealisierung der monogamen Paarbeziehung führte dazu, dass ich jedes Scheitern einer romantischen Begegnung als existentielle Bedrohung wahrgenommen habe, die stets zu extremem Leid führte.
Meine Grübelei hat unzählige schöne Momente für immer ruiniert, weil ich in diesen Momenten immer schon die Zerstörung im Kopf hatte. Entspannung war die Ausnahme, Sorgen machen die Norm.
Meine Verantwortungsübernahme hat dazu geführt, dass viele meiner vermeintlichen Freundschaften eher Verältnisse zwischen Wegweiserin und Wegsuchender waren, die mich mehr Energie kosteten als sie mir gaben.
Und mein Vermeidungsverhalten führte direkt in die Angststörung, die mich – so kann ich es rückblickend nur sagen – mindestens zehn Jahre meines Lebens gekostet hat. In kleinen Schritten haben Grübelei und Vermeidung meinen Entfaltungsraum immer weiter verkleinert und den Raum für meine Sorgen und Ängste immer mehr vergrößert. Bis ich im Zuge meiner Großkrise und der sie begleitenden Verhaltenstherapie auf mein Leben blickte und mich fassungslos fragte, wie ich es so weit hatte kommen lassen.
Was mich in all den Jahren davon abhielt, bei mir selbst die krankheitswerte Vermeidung zu erkennen? Sie passte nicht zu meinem Selbstbild. Ich war jemand, der vorausgeht, jemand, der sein Leben selbstbestimmt lebt, ein Alphatier. Angst passte da nicht hinein und deshalb übersah ich, dass mein Leben längst nicht mehr selbstbestimmt, sondern ein einziger Spießrutenlauf zur Stressvermeidung geworden war. Wegen meiner zwanghaften Verantwortungsübernahme hatte ich mich außerdem die meiste Zeit dieser Phase ganz darauf konzentriert, meiner Mutter bei ihrer jahrelangen Generalisierten Angststörung zu helfen.
Als introvertierter Mensch, als Mensch also, der viel Qualität aus dem Alleinsein zieht, fielen außerdem viele meiner Vermeidungsstrategien nicht auf. Wenn ich wochenlang außer meinem damaligen Ehemann keine Menschenseele traf, konnte das eben nicht nur krankhaftes Verhalten sein, sondern auch Ausdruck meiner tatsächlich gesunden Natur, die Stille liebt und die Freiheit von gesellschaftlichen Konventionen, wie man sie nur im Alleinsein erlebt. Ich kann daher rückblickend nicht sagen, wann genau ich die Grenze zur Angststörung überschritt. Ich weiß nur, dass der Weg in mein eigenes psychisches Gefängnis in vielen, winzig kleinen Mauseschrittchen erfolgte. Die Diagnose, die meine Therapeutin schließlich stellte, war nur die nachträgliche Benennung einer Lebensweise, die mich mindestens zehn Jahre lang begleitet hat.
Überlebensstrategien als normales Verhalten
Das Problem bei diesen und anderer Empfindungsstrukturen ist, dass sie oft schon im Kindesalter entstehen. Das kindliche Gehirn entwickelt allerlei Strategien, um mit emotionalen Defiziten umzugehen. Die Psychologie nennt das Überlebensstrategie. Vereinfacht gesagt, macht sich das Kleinkind seinen ganz eigenen Reim auf frühkindliche Erfahrungen – ganz gleich, ob es sich dabei um objektive Erfahrungen, wie schwere Traumata, oder nur subjektive, etwa eher gefühlsarme oder leistungsorientierte Eltern handelt. Es ist wichtig zu wissen, dass auch Kinder, die nicht Opfer von Misshandlung oder Vernachlässigung geworden sind, in ihrem kleinen Gehirn Schlüsse aus dem Verhalten ihres Umfeldes ziehen können, die später im Erwachsenenalter zu Problemen führen können.
Typische Kleinkindstrategien sind:
- Probleme, eigene Grenzen zu setzen
- Schuldgefühle
- Verantwortungsübernahme
- Vermeidungsverhalten
- Kontrollzwang und Probleme, anderen zu vertrauen
- Anpassung an andere (‘people pleaser’)
- Harmoniesucht
- Sehnsucht nach romantischer Verschmelzung mit einer/m Partner/in
- extreme Kränkung und Verletzung nach dem Verlassenwerden
Man könnte diese Liste noch eine Weile weiterführen, aber es geht hier nur um das Prinzip. Das kindliche Gehirn überlegt sich Wege, mit emotionalen Defiziten und Bedürfnissen umzugehen, und diese Wege begleiten uns, wenn wir nicht durch äußere Hilfe in die Lage versetzt werden, diese Muster aufzuknacken, ein Leben lang. Sie beeinflussen unsere Partner- und Arbeitswahl, den Verlauf von Konflikten in sozialen Verbindungen und unsere Entscheidungen an jedem Tag.
In schwierigen Situationen greifen die kindlichen Überlebensstrategien oft automatisch und schneller als man sie sich bewusst machen kann. Es sind Verhaltensautomatismen, die wie ein Instinkt in Sekundenbruchteilen anspringen. Und diese extrem früh entwickelten Verhaltensmuster machen uns im Erwachsenenalter das Leben schwer – auch wenn noch kein Krankheitswert vorliegt. Und da wir von klein auf mit ihnen groß geworden sind, denken wir “So bin ich eben”. Weil uns überhaupt nicht klar ist, dass unserer innerer Taktgeber kein vernünftiger, bewusst handelnder Erwachsener ist, sondern ein Kleinkind, das ein gewohntes Programm abspult, ob es nun der Situation angemessen ist oder nicht.
Das kindliche Gehirn muss erwachsen werden
Auf der Grenze zwischen “psychisch gesund” und “psychisch krank” steht also ein Kleinkind und dieses Bild macht eigentlich schon klar, warum es sinnvoll sein kann, sich mit der eigenen Psyche zu befassen, auch wenn Verhaltensweisen noch keinen Krankheitswert haben. Unser Inneres Kind kann mit seinen Strategien zwar zu psychischen Erkrankungen führen, muss es aber nicht. Und dennoch: Um wirklich “gesund” zu werden, müssen wir uns Wege erarbeiten, erwachsen zu agieren.
Therapien können dabei helfen, sich zum einen diese Denk- und Verhaltensmuster klar zu machen und zum anderen die Kommunikation zwischen unserem Erwachsenen- und dem Kindanteil zu verbessern. Denn das kommt erschwerend hinzu: Erfahrungen im Kindesalter werden in anderen Teilen des Gehirns gespeichert als solche im Erwachsenenalter. Das liegt daran, dass wir Menschen bei der Geburt nur 30% des Gehirnvolumens eines Erwachsenen haben – große Teile des Gehirns existieren noch gar nicht, wenn das Kleinkind anfängt, sich einen Reim auf seine Umwelt zu machen. Auch diese räumlich-physische Trennung des kindlichen vom erwachsenen Teil macht es so schwer, die Verhaltensautomatismen zu durchbrechen.
Für einige Kindstrategien scheint es außerdem eine Veranlagung zu geben, sowohl Depressionen als auch bei Angststörungen häufen sich gerne in Familien. In meiner müttelichen Familie ist Vermeidungsverhalten bis zu den Großeltern nachvollziehbar, in der Familie meines Vaters eher eine gewisse Kontrollsucht. Von Familien, in denen sich Fälle von Schizophrenie oder Suizid häufen, liest man immer wieder. Sofoern es wirklich eine genetische Komponente gibt, bedeutet das also, dass man auch dann noch einen Hang zu der jeweiligen Störung, wenn man das Innere Kind zur Kooperation gebracht hat.
All das macht es aber nicht aussichtlos, sich mit der eigenen psychischen Gesundheit zu befassen. Ich lebe heute nahezu vollkommen angstfrei. Die übersteigerten Sorgen, die ich früher jeden Tag und in unterschiedlichsten Situationen hatte (weil ‘So bin ich eben’), kenne ich heute nur noch als Begleiterscheinung einer depressiven Episode. Das bedeutet, meine Therapie, die ich anlässlich meiner Großkrise begonnen habe, hat mir weit über diese Großkrise mit Krankheitswert hinaus geholfen. Sie hat mich in die Lage versetzt, die verschiedenen Belastungen, die mich mein Leben lang begleitet und mir Lebensqualität genommen, die Konflikte zu Katastrophen und das Singlesein zu einer Qual gemacht haben, zu überwinden. Ich sehe sie nicht mehr länger als “So bin ich eben” an, sondern als “Ich wurde so und habe es überwunden”.
Viele Menschen träumen davon, irgendwann einen Zustand zu erreichen, den sie als Glück definieren. Als Zufriedenheit, inneren Frieden.
Und vielleicht würde es das Bewusstsein für psychische Arbeit viel mehr schärfen, wenn man den Menschen klar macht, dass der Weg dahin bei ihrer Psyche beginnt – ganz gleich, ob diese schon “krank” oder noch “gesund” ist.


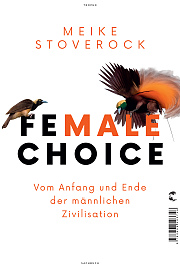



Neueste Kommentare